Tötet sie!
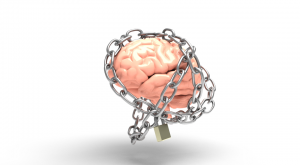 Oder warum Mark Twain der heutigen Journaille nicht einmal mehr die Sechstausenddollarschuhe putzen dürfte.
Oder warum Mark Twain der heutigen Journaille nicht einmal mehr die Sechstausenddollarschuhe putzen dürfte.
Ich wollte diesen Beitrag schon vor gut fünfunddreißig Jahren schreiben. Allerdings kannte ich da nur die DDR-Strophen des Liedes „Wessen Brot ich esse, dessen Lied singe ich.“ Dass es in der heutigen Zeit noch weitere geben würde, hätte ich nicht erwartet. Aber es macht keinen Unterschied. Das, um was es geht, ist zeitlos.
Zwei Vorbemerkungen erlaube ich mir. Erstens halte ich das Wort „Wir“ in der heutigen Zeit für die gefährlichste Waffe der deutschen Politik und des deutschen Journalismus. Es wird immer dort verwendet, wo Gemeinsamkeiten heraufbeschworen werden sollen, die in Wirklichkeit nicht existieren. „Wir schaffen das“, ist eine so klare Aussage, dass noch niemand gefragt hat, wer und was mit dem „Wir“ gemeint war. Alle Welt ist davon ausgegangen, dass „wir Deutschen“ gemeint war, also die, die schon länger hier leben. An wir „cleveren Politiker“, „wir Trickser“, „wir Grundgesetzaushebeler“ hat niemand gedacht. Ich übrigens auch nicht. Ich denke Schlimmeres.
Über das „Was“ hat auch keiner nachgedacht. Jeder ist davon ausgegangen, es war die Aufnahme von ein paar einhundert Millionen vor politischer Verfolgung und Krieg flüchtender Afrikaner. Die Frage, ob „wir schaffen das“ nicht nur der erste Teil eines zusammengesetzten Satzes war, von dem der zweite Teil lautete: „ … unsere Wähler aufs Kreuz zu legen, die Bundeswehr zu ruinieren, unsere Macht zu zementieren und die Kuscheltierindustrie vor dem Ruin zu retten“, ist dann auch nicht näher erörtert worden.
Da das „Wir“ also ein bisschen abgenutzt ist, bleibt mir nichts anderes übrig, als diesen Beitrag aus der personalen Perspektive zu schreiben. Das passt auch besser, schließlich gibt er nur meine Meinung wieder, die in Deutschland, so viel ich weiß, wenn sie nicht der gängigen politischen Richtlinie entspricht, zwar mit Ausgrenzung, Bashing, Arbeitsplatzverlust, Facebooklöschung und dem mittlerweile fast schon einem Ritterschlag gleichenden Attribut „rechtsextrem“ bestraft werden kann, aber noch nicht nach dem Gesetz.
Zweitens habe ich nichts studiert, was in irgendeiner Weise Journalismus auch nur nahe kommt. Wenn ich trotzdem einen Beitrag über das schreibe, was in der heutigen Zeit als solcher bezeichnet wird, so deshalb, weil ich mich als Opfer davon betrachte und wenn ich mich recht erinnere, so steht einem zum Tode Verurteilten noch ein letzter Wunsch zu. Tatsächlich sehe ich mich als Konsument der journalistischen Meisterleistungen von ARD/ZDF, Spiegel und Konsorten so – verurteilt zum Tod durch Verblödung.
Der Grund sind die Worte eines großen, lange vor mir verstorbenen Mannes – Mark Twain: „Wenn Sie ein Adjektiv sehen, töten Sie es.“
Jedem, der sich ernsthaft mit Schreiben beschäftigt, wird dieser Satz früher oder später eingeprügelt. Er hat seine absolute Berechtigung und seine Nichtbeachtung ist der Grund für das Scheitern vieler Autoren. Was ja nicht weiter schlimm ist, denn dieses Scheitern scheint mir so etwas wie die perfekte Bewerbung für die Anstellung als Journalist bei den so genannten Mainstreammedien zu sein und damit für ein gesichertes Auskommen, dass die Autoren guter Bücher in Deutschland eher weniger haben.
Ich meine, wer liest denn noch Schinken, bei denen man selbst denken muss, weil keine erklärenden Attribute und Adjektive vorhanden sind? Selbst denken ist völlig out, man lässt heutzutage nicht nur die Kinder die Welt retten oder Bots Facebookdiskussionen führen – nein, denken überlässt man den Machern der Medien und konsumiert nur das, was sie gedacht haben, was gedacht werden soll. Schließlich kommt es immer anders, wenn man selber denkt und wer will das schon?
Jeden Abend, wenn sich Claus Kleber räuspert, wissen Sie, dass Sie sich zurücklehnen und entspannen können, denn jetzt wird Ihnen die Welt erklärt. Vielleicht beschleicht Sie ja ab und zu der Wunsch, das Gesagte etwas anders zu interpretieren, aber das wäre Arbeit und wozu sollen Sie sich diese machen, wenn der Erklärbär Sie Ihnen schon abgenommen hat. Ist halt ein Netter, der gute Claus und wie sie alle heißen. Um zu verstehen, wie viel er wirklich für Sie tut, muss ich ein wenig Theorie über Attribute und Adjektive einschieben. Beide bewirken etwas, das in Nachrichten und in guten Büchern nur wenig zu suchen hat: Sie geben die Meinung dessen preis, der sie benutzt. Sie verraten, was er fühlt, was er denkt oder was er Sie denken machen möchte. Die deutsche Bezeichnung für ein Adjektiv ist „Eigenschaftswort“ und genau das tut es – es verleiht eine Eigenschaft. Oder, um es korrekt auszudrücken, derjenige, der es verwendet, verleiht oder erläutert eine Eigenschaft des Hauptwortes. Er erklärt es und es ist seine Sache, ob diese Erklärung korrekt ist.
Ein ganz einfaches Beispiel dazu: „Morgen wird es warm.“ So könnte ein Wetterbericht beginnen, meinen Sie? Da liegen Sie falsch. So könnte ein Kommentar dazu beginnen, aber nicht der Bericht selbst. „Warm“ ist ein Adjektiv und es gibt das Empfinden dessen wieder, der es verwendet. Nehmen wir an, es ist April, die heutige Temperatur betrug zehn Grad und morgen werden achtzehn Grad erwartet. Für den Sprecher mag das warm sein, doch wie wird ein Nordafrikaner darüber denken? Korrekt wäre also die Angabe der zu erwartenden Temperatur. Das bringt nur ein Problem – Sie müssten selbst entscheiden, ob sie die Jacke zu Hause lassen oder nicht. „Morgen wird es warm“, nimmt Ihnen diese Entscheidung ab, wenn Sie sich darauf verlassen, statt selbst zu denken.
Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: Sie, im Urlaub in Griechenland, in Badehose auf einem Felsen und fünf Meter unter Ihnen glänzt das wunderbar azurblaue Wasser des Mittelmeeres. Den Grund können Sie nicht sehen und Sie überlegen, ob sie hineinspringen sollen. Es ist zu verführerisch, die Mädels lachen schon und sie können sich nicht entscheiden. Eine Querschnittslähmung ist eine ziemlich hässliche Sache. Plötzlich steht Marionetta Slomka neben Ihnen, im Bikini, wunderbar nicht von Schminke, sondern von der Sonne gebräunt, und sagt zu Ihnen im Brustton der Rechtschaffenheit, wie sie ihn auch beim Verlesen der Nachrichten anschlägt: „Das Wasser ist tief hier.“
Was würden Sie tun? Ihr Leben hängt von einem Adjektiv ab, dass die gute Dame benutzt hat. Würden Sie springen? Ohne nachzudenken? Nein? Warum denn nicht, Sie tun es doch sonst jeden Abend. Schließlich lassen Sie doch von der Dame neben Ihnen einen großen Teil Ihres Denkens und damit Ihres Lebens bestimmen, ohne darüber nachzudenken, ob sie Recht hat mit dem was, sie sagt.
Es gibt Attribute, die sind unverzichtbar. Wie eben dieses „unverzichtbar“. Manchmal geht es nicht ohne, zum Beispiel bei Vergleichen und Unterscheidungen. „Die deutsche Industrie entwickelt sich langsamer als die asiatische.“, oder „Sieht die rote oder die blaue Bluse besser aus?“
Aber alles darüber hinaus ist eine Wertung, eine subjektive Einschätzung des Erzählenden und es sollte Ihre Entscheidung sein, ob Sie dieser Wertung zustimmen oder es, nach dem Sie darüber nachgedacht haben, nicht tun. Attribute können sich an vielen Stellen verstecken und manchmal ist es gar nicht so einfach, auf sie aufmerksam zu werden. Dazu ein paar Beispiele.
Adjektiv als Attribut: Den hässlichen neuen Hut hat mir mein Freund geschenkt.
Partizip als Attribut: Den lärmenden Bengel setze ich vor die Tür.
Adverb als Attribut: Den Ferrari dort möchte ich probefahren.
Genitivattribut: Der Aufsatz meines Schülers ist schrecklich.
Präpositionales Attribut: Wir wollten im Sommer mit dem Auto nach Kroatien fahren.
Attributsatz: Den Hut, den du von deinem Freund geschenkt bekommen hast, finde ich schrecklich.
Apposition: Baschar al-Assad, der Fassbombenwerfer in Syrien, wird gestürzt.
Wie Sie in allen Beispielen sehen, stellt das Attribut in seinen verschiedenen Formen eine Erklärung, sogar eine Wertung, dar. Eine nähere Erläuterung aus der Sicht des Erklärenden. Attribute gehen im gesprochenen Satz unter und werden meistens nur bewusst wahrgenommen, wenn sie einen inneren Widerspruch wecken. Mit einigem Geschick kann man also durch die Verwendung entsprechender Attribute und ihre häufige Wiederholung ein Wertesystem auf den Kopf stellen. Nein, ich meine nicht das westliche Wertesystem, das steht da schon lange. Aber nehmen Sie den letzten Beispielsatz. Wie anders klingt er ohne die Apposition: „Baschar al-Assad wird gestürzt.“
Natürlich, Ihre instinktive Sympathie wäre sofort auf seiner Seite. Schließlich wollen Sie nicht, dass irgendwer irgendwo gestürzt wird. Also braucht es eine Erklärung, weil Sie ja nicht wissen können, dass der Mann ein Bösewicht ist. Kommt sofort:
„Keine Panik, wir sind die Guten, wir sorgen dafür, dass sie ohne Gewissensbisse schlafen können. Warum er gestürzt werden muss? Der Mann hat Fassbomben geworfen, das sind hässliche Dinger mit Sprengstoff und Nägeln darin. Naja, nicht er selbst. Das hat er machen lassen. Ob wir das genau wissen? Aber natürlich, wir haben da eine Quelle und Sie verstehen doch, dass wir die nicht einfach so nennen können. Was, internationaler Gerichtshof? Wissen Sie, wie lange das dauert? *Hüstel*, ist halt ein bisschen komplizierter, aber das zu erklären, dauert lange und wir haben dafür nicht die Zeit.“
Merken Sie etwas? Jede Erklärung wirft Fragen auf und eine beantworte Frage zwei neue Fragen. Es sei denn, die Erklärung wird in ein Attribut gepackt. Das schleicht sich über die Hintertür ins Gehirn, setzt sich dort fest und es braucht nicht erklärt zu werden. Weil niemand fragt. Ich bin ein ordentlicher Mensch, auch in meinem Kopf, und so reicht es mir, wenn ich etwas einen Zettel ankleben und es in das richtige Fach sortieren kann. Ob der Zettel und das Fach stimmen, ist nicht so wichtig, Hauptsache wegsortiert. Aufkleber drauf und fertig. Das hatten wir schon einmal, ist nur so lange her, dass sich keiner mehr daran erinnern will, wie es wirklich war. Nur noch die Begriffe sind geblieben und das viele Leute rechts und links nicht unterscheiden können, ist nicht nur ein Problem im Straßenverkehr.
„Rechtsextrem?“ Alles klar, hinterm Hippocampus, dritte Tür links. „Sozialverträglich“? Irgendwo in der Nähe vom Kleinhirn. „Verschwörungstheoretiker?“ Mist, das Fach ist voll, da liegen auch die Seenotrettungsleugner drin, war viel los die letzte Zeit. Aber halt, bei den Nazis ist noch Platz, ist sowieso kein großer Unterschied. Bei den nächsten Nachrichten habe ich dann das beruhigende Gefühl, über alles Bescheid zu wissen. Ha, alter Hut, kenne ich, ich weiß sogar noch auf Anhieb den Weg zu dem Fach, in das ich Salvini packen muss.
Mit dem eben Gesagten habe ich den Teil übersprungen, in dem ich der Frage nachgehe, ob die massenhafte Verwendung von Attributen in den täglichen Nachrichten auf Unfähigkeit oder auf wohlberechneter Absicht beruht. Das hat seinen Grund, denn wenn ich alle drei Monate auf meinen Kontoauszug mit der GEZ-Gebühr schaue, muss ich davon ausgehen, dass die Nachrichten von hochbezahlten Profis gemacht werden. Profis, die genau wissen, was sie tun.
Es wäre schön, wenn ich wenigstens wüsste, warum sie das tun. Oder für wen. Aber das sagen mir ihre als Nachrichten verkauften Meinungen nicht.
Hinweis: Dieser Artikel kann frei verlinkt, kopiert und geteilt werden.
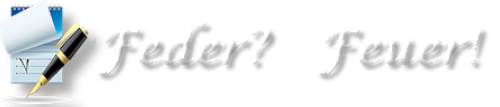

 In jungen Jahren ist Lebenszeit etwas, über das wir uns kaum Gedanken machen. Höchstens, wenn wir wünschen, dass sie schneller vergehen möge, damit wir endlich als erwachsen angesehen werden und unsere Ziele und Träume erfüllen können. Unser Konto ist gefüllt, ein Ende nicht in Sicht und scheinbar ist niemand da, der uns Grenzen setzt. Wir verschwenden keinen Gedanken daran, dass die Anzahl der Schritte, die wir in unserem Leben tun können, endlich ist, und dass wir mit jedem verschwendeten Gedanken auch Zeit von unserer Lebensuhr nehmen.
In jungen Jahren ist Lebenszeit etwas, über das wir uns kaum Gedanken machen. Höchstens, wenn wir wünschen, dass sie schneller vergehen möge, damit wir endlich als erwachsen angesehen werden und unsere Ziele und Träume erfüllen können. Unser Konto ist gefüllt, ein Ende nicht in Sicht und scheinbar ist niemand da, der uns Grenzen setzt. Wir verschwenden keinen Gedanken daran, dass die Anzahl der Schritte, die wir in unserem Leben tun können, endlich ist, und dass wir mit jedem verschwendeten Gedanken auch Zeit von unserer Lebensuhr nehmen.
